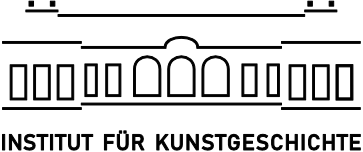2024 – Venedig
Exkursionsbericht zur 60. Biennale di Venezia
Freitag, 21. September – Anreise nach Venedig
Unsere Exkursion zur 60. Biennale di Venezia begann am Freitagmorgen mit der Anreise per Bahn. Bereits im Vorfeld gab es einige Herausforderungen – eine ausgefallene Zugverbindung, schwierige Alternativen und ein kleiner Zwischenfall, bei dem ein Mitreisender fast den Anschluss verpasste. Dennoch erreichten wir gemeinsam unser Ziel planmäßig am frühen Abend. Unser Hotel, ein ehemaliges Kloster in Bahnhofsnähe, war nicht nur praktisch gelegen, sondern bot auch eine besondere Atmosphäre für unsere Zeit in Venedig. Den restlichen Abend nutzten wir, nach kurzer Besprechung und dem Erhalt der Biennale-Tickets etc. zur freien Gestaltung, um uns mit der Umgebung vertraut zu machen und in eigenen Gruppen ein Abendessen zu genießen.
Samstag, 22. September – Erste Pavillonbesuche
Nach einem gemütlichen Frühstück mit möglichem Blick auf einen venezianischen Kanal begann unser offizielles Programm mit einer Vorbesprechung im Hotel. Anschließend machten wir uns auf den Weg zur Biennale, die dieses Jahr unter dem Titel „Foreigners Everywhere“ stand, kuratiert von Adriano Pedrosa. Bereits auf der Vaporetto-Fahrt Richtung Giardini fielen die ersten Besonderheiten Venedigs ins Auge – darunter die geschichtsträchtigen Fassaden, das geschäftige Treiben entlang der Promenade und bereits stark besuchte Sehenswürdigkeiten, wie die Rialtobrücke.
Unsere erste Station war tatsächlich ein ‚Außenposten‘ – Pavillons die sich nicht in den Giardini und Arsenale befanden. Die damit verbundene Präsentation behandelte den Äthiopischen Pavillon – und damit auch die erste Teilnahme des Staates an der Biennale. Der berufene Künstler Tesfaye Urgessas thematisierte mit mehreren Werken in drei Räumen Identität, Migration und Zugehörigkeit durch figurative Malerei, die Emotionen ohne Wertung präsentierte.
Anschließend besuchten wir die Ausstellung im Arsenale. Aufgrund des engen Zeitplans und den vielen Pavillons konnten wir nur einen kurzen Überblick über die präsentierten Werke der ‚Internationalen Ausstellung‘ gewinnen, die sich am Eingang des Arsenales erstreckte. Nach dieser folgte die zweite Präsentation im Beninischen Pavillon. Hier wurden von mehreren Künstler*innen Themen wie Gender aus einer afrikanischen Perspektive, Kolonialismus und Vodoo thematisiert. Die Werke stellten eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft her und verdeutlichten die historische Bedeutung Benins.
Im Anschluss besichtigten wir den Südafrikanischen Pavillon, der mit einer immersiven Soundinstallation „Quiet Ground“ die Themen der Land- und Wasserrechte bearbeitete. Besonders beeindruckend war die Art, wie in einer dunklen sowie warmen Atmosphäre traditionelle Lieder und Interviews mit Landarbeiter*innen miteinander verwoben wurden, um Geschichte und Identität erlebbar zu machen.
Die vierte Präsentation führte uns zum Saudischen Pavillon, dessen Ausstellung „Shifting Sands: A Battle Song“ auf den ersten Blick als eine Plattform für die Stimmen saudischer Frauen wirkte. Bei näherer Betrachtung war jedoch nicht zu übersehen, dass es sich möglicherweise auch um eine Form von ‚Artwashing‘ handelte, da kritische Elemente in der Ausstellung stark abgeschwächt waren.
Die nächste Station führte uns zum mexikanischen Pavillon. Das dort gezeigte Werk „Nor marchábamos, regresábamos siempre“ des mexikanischen Künstlers Erick Meyenberg mit deutsch-libanesischen Wurzeln thematisierte Migration und Zugehörigkeit, indem es die persönliche Erfahrung des Künstlers transgenerationaler Identität verknüpfte. Dieses Werk stand auch im Kontrast zu frühen internationalen Auftritten Mexikos im 20. Jahrhundert, die von der mexikanischen Schule geprägt und vom Staat anerkannten Künstler*innen bespielt wurden.
Die letzte Präsentation des Tages fand im chinesischen Pavillon statt, der unter anderem eine Sammlung historischer Werke und Dokumente unter dem Motto „Harmony in Diversity“ präsentierte. Während einige die Dokumentation schätzten, wurde die kuratorische Auswahl, Präsentation und der thematische Kontext der Ausstellung kritisch hinterfragt.
Zum Abschluss des Tages reflektierten wir unsere bisherigen Eindrücke in einer gemeinsamen Diskussion im Arsenale und nutzten ebenfalls die Gelegenheit den Biennale-Shop unsicher zu machen. Zuletzt ließen wir den Abend gemütlich in Gruppen mit verschiedenen Zielen ausklingen.
Sonntag, 23. September – La Certosa und Giardini
Unser zweiter Tag begann mit einer Fahrt zur Insel La Certosa, die als zusätzlicher ‚Außenposten‘-Standort (was keinesfalls üblich ist) des Deutschen Pavillons diente. Die dort gezeigten Klanginstallationen nutzten den besonderen Ort, um Übergänge von Raum und Zeit erlebbar zu machen. Hier stellte auch der Nürnberger Künstler Robert Lippok sein „Feld“ aus – ein Netz aus 12 in die Wiese eingelassenen Tieftonlautsprechern, Schallreflektoren und Verstärkern, welches das Bewusstsein für die Geschichte des Ortes wecken soll. Überschattet wurde dieser Besuch durch einen Komplott der heimischen Mücken gegen unsere Exkursionsgruppe. Wir nahmen die Stiche der Kunst wegen hin (und immerhin sind wir es, die in ihr Gebiet eingedrungen sind).
Von La Certosa fuhren wir schließlich in die Giardini, wo wir den Deutschen Pavillon selbst besuchten. Die Ausstellung „Thresholds“ thematisierte zum einen Migration in einer Gegenüberstellung von Gastarbeitenden der BRD und DDR sowie zum anderen Übergangszustände von einer post-apokalyptischen Fluchtfantasie zu einer neuen, utopischen Realität. Die Referentin nahm dabei nicht vorweg, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dessen neoklassizistischen Pavillon auf der Biennale seit der Nachkriegszeit auch sehr üblich ist.
Im Anschluss ging es zum Bolivianischen Pavillon, der im Russischen Pavillon untergebracht war. Eine weitere Besonderheit der vergangenen Biennale. Die politische Dimension dieser ‚Geste‘ – ein mögliches Rohstoffabkommen – wurde ebenso diskutiert wie die künstlerischen Arbeiten, die sich mit kolonialen Narrativen auseinandersetzten.
Es folgten Besuche zum Nordischen Pavillon, dessen audiovisuelle Installation eine mythologische Seereise und das Thema Diaspora aufgriff und zum Israelische Pavillon jedoch noch vor Beginn der Biennale aus Protest des kuratorischen und künstlerischen Teams geschlossen wurde. Stattdessen fand sich am Eingang ein Statement des Teams, das die Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und Palästina forderte. Trotz der reduzierten Präsentation hinterließ der Pavillon einen starken Eindruck – auch mit einer bewaffneten italienischen Wache am Pavillon. Mit einem aus Bambus konstruierten Drachenkopf hatte auch der benachbarte Nordische Pavillon eine besondere Außenwirkung.
Danach folgte der Amerikanische Pavillon, wo der Künstler Jeffrey Gibson indigene, queere und popkulturelle Elemente verband, und mit Farben, Muster sowie Textfragmenten vermitteln wollte, dass indigene Kunst nicht nur Tradition, sondern auch zeitgenössische Praxis ist.
Ebenso besuchten wir den Polnischen Pavillon, in welchem das Kollektiv ‚Open Group‘ ein eindringliches und partizipatives Werk zur Kriegserfahrung in der Ukraine präsentierte, sowie den Rumänischen, wo der Künstler Șerban Savu den Pavillon mit sozialistische Bildwelten verfremdete, um gesellschaftlichen Wandel von der Vergangenheit zur Gegenwart zu thematisieren.
Auch im Giardini nutzten wir die Gelegenheit weitere Pavillons nach eigenem Ermessen zu besuchen oder uns auch mithilfe der Essenständen der Giardini zu kräftigen.
Nach dieser Ausstellungsstätte folgte zuletzt noch ein weiterer ‚Außenposten‘ – der Nigerianische Pavillon. „Nigeria Imaginary“ reflektierte Nigerias Geschichte und Zukunft durch eine diasporische Perspektive. Multimedial thematisierten die Künstler*innen Kolonialismus, Moderne und Protestbewegungen. Viel Zeit blieb uns allerdings nicht, um die Ausstellung in aller Ruhe zu betrachten. Zur späten Uhrzeit wurden wir schließlich zum Verlassen des Hauses gebeten.
Nach dem intensiven Programm ließen wir uns in den Abend fallen und den Tag in einem längeren, gemeinsamen Essen an der venezianischen Promenade ausklingen.
Montag, 24. September – Abschluss und Abreise
Montags waren die verschiedenen Ausstellungsstätten der Biennale geschlossen, weshalb wir unsere letzten Präsentationen im Garten des Hotels abhielten. Vorgestellt wurde die Biennale-Bibliothek, deren umfangreiche Sammlung zur Dokumentation zeitgenössischer Kunst beiträgt. Ein weiterer Beitrag – damit die 16te und letzte Präsentation – behandelte den Bosnisch-Herzegowinischen Pavillon, dessen Skulptureninstallationen sich mit dem Meer als Grenze und Identitätsraum auseinandersetzten.
Zum Abschluss stand noch die „Breast“-Ausstellung auf dem Programm, eine im Palazzo Franchetti von der Unterwäschemarke ‚intimissimi‘ geförderte Ausstellung, die verschiedene künstlerische Perspektiven auf das Thema Brust darstellte. Auch diese blieb dem kritischen Blick der Exkursionsgruppe nicht fern, sowohl auf inhaltlicher, visueller, kommerzieller als auch ethischer Ebene wurde sie konsequent diskutiert.
In einem illustren Café beim Palazzo ließen einige unserer Gruppe die Exkursion Revue passieren oder vertieften sich in persönliche Gespräche. Es bot sich eine letzte Gelegenheit Venedig auf eigene Faust zu erkunden, bevor wir uns zum Abschluss unserer Reise wieder im Hotel trafen. Während einige direkt abreisten, nutzten andere die Gelegenheit, länger in Venedig zu bleiben und die letzten warmen Herbsttage mit eigenem Programm zu genießen.
Fazit
Die Exkursion zur 60. Biennale di Venezia war eine intensive und bereichernde Erfahrung. Die Vielfalt der künstlerischen Positionen spiegelte das Motto „Foreigners Everywhere“ eindrucksvoll wider und eröffnete zahlreiche Perspektiven auf Identität, Migration und globale politische Entwicklungen. Sie zeigte, wie Kunst zum Reflexionsraum für aktuelle gesellschaftliche Fragen wird. Neben den fachlichen Diskussionen war die Exkursion auch eine wunderbare Gelegenheit, sich innerhalb der Gruppe auszutauschen und sich an der besonderen Atmosphäre Venedigs zu erfreuen.
Daniel Bucher